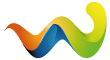Softwarepatente kommen trotz Brüssels "Nein".
Eine interssante Stellungnahme zum Thema gab Meir Pugatch von der Universität in Haifa anläßlich einer Tagung "Digital Europe" der PFF (Progress & Freedom Foundation), einer neoliberalen US-amerikanischen Vereinigung, ab:
"Die Vertreter der Gegenseite, die sich für eine Begrenzung geistiger Eigentumsrechte stark machen, konstituieren sich immer nur für eine konkrete Kampagne, ihre Bewegung fällt danach wieder auseinander. Große Unternehmen verfolgen dagegen langfristigere Strategien und betrachten auch eine kurzfristige Niederlage nur als kleinen Rückschritt in einem langen Kampf."
Das ist auch irgendwie offensichtlich, denn Privatpersonen können es sich im Gegensatz zu großen Firmen nicht leisten, über Jahrzehnte hinweg ununterbrochen einen solchen "Kampf" zu führen. Doch was heißt das im Klartext? Nichts anderes, als daß diese großen Unternehmen demokratische Entscheidungen nicht akzeptieren, solange sie nicht nach ihrem Geschmack ausfallen. Dies ist auch ganz natürlich so, denn die Grundüberzeugung der Führungskräfte in großen Konzerne für ihr gesamtes unternehmerisches Handen lautet "Ein Nein ist keine Antwort", was man in vielen Veröffentlichunen nachlesen kann. Anders formuliert: Demokratische Entscheidungen werden solange negiert und ignoriert, und nach kurzer Zeit erneut notfalls durch die Hintertür zur Abstimmung gebracht, bis das Ergebnis den eigenen Wünschen entspricht.
Auch die tschechische Informatikministerin, Dana Berova, geht davon aus, daß die Auseinandersetzung um Softwarepatente noch Jahre andauern wird.
So etwas nennt man Zermürbungsstrategie. Ist eine demokratische Entscheidung nicht zur Zufriedenheit einer Interessengruppe mit genügend finanziellen Möglichkeiten ausgefallen, so wird sie von dieser solange als nicht gefällt betrachtet und erneut auf die Tagesordnung gesetzt, bis die Parlamentarier sich entnervt endlich dazu bequemen "richtig", soll heißen im Sinne der Lobby, abzustimmen.
Und solange werden die ausführenden administrativen Stellen dazu genötigt, im Vorgriff auf die bei solcher Vorgehensweise zu erwartende künftige Regelung die vorhandenen Gesetze kräftig in die gewünschte Richtung zu dehnen. Das setzt unumkehrbare Fakten.
In der Realität sieht es so aus, daß bis jetzt bereits über 30.000 Softwarepatente erteilt wurden, obwohl die europäische Gesetzgebung mit der letzten Entscheidung in eine andere Richtung weist. Mit rechtsstaalichen Grundsätzen ist so etwas fast nicht vereinbar. Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf.
Und so wird kommen, was mehrheitlich abgelehnt wird. Ganz einfach, weil es einigen internationalen Großkonzernen nützlich ist, die mit "Patenten auf Vorrat" auf Jahre hinaus jede Innovation anderer blockieren. Kein Erfinder, künftig auch kein Programmierer kann sicher sein, nicht irgendwann für seine Erfindung in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt zu werden. Und ein volkswirtschaftlicher Unsinn erster Güte sind sie dazu. Unsummen müssen jährlich dafür aufgewendet werden, um "Workarounds" für Patente zu entwickeln, deren Nutzung vom Inhaber nicht oder nur zu völlig überzogenen Bedingungen gewährt wird. Damit werden Kräfte sinnlos für die Parallelentwicklung bereits vorhandener Technologie verpulvert, statt sie in wirkliche Neuerungen zu stecken. Und oft genug sind die Ergebnisse dieses Hindernislaufes nicht so gut, wie das aufgrund des Patentschutzes für eine Weiterentwicklung nicht verfügbare Original. Hätte ich beispielsweise das Patent auf den Trinkbecher, so könnte ich jedem anderen untersagen, einen Henkel dafür zu entwickeln. Nur mit meiner Zustimmung könnte die Tasse erfunden werden. Für zwanzig lange Jahre habe ich dieses Monopol, und das wird weidlich ausgenutzt.
Nur ein Beispiel von vielen für Innovationsblockade durch Patente: Der elektronische Film für Spiegelreflexkameras ist bereits seit Jahren technisch machbar. Aber auf den Markt wird er wohl so schnell nicht wieder kommen (zumindest nicht bevor dieser Kameratyp nur noch historischen Wert hat), denn das entsprechende Patent wurde von Kameraherstellern aufgekauft, um es rasch in der Schublade verschwinden zu lassen. Wer diese Technologie nutzen möchte, hat sich gefälligst eine komplette Elektronische Kamera zu kaufen, mit dem gesamten teuren Zubehör an Objektiven etc, statt einem relativ günstigen elektronischen Film. Klar, das verspricht mehr Profit...
Mit juristischen Winkelzügen lassen sich sogar bereits lange in Anwendung befindliche Vefahren nachträglichem Patentschutz unterwerfen. Als Folge wird allen bisherigen Anbietern untersagt, ihr Produkt weiterhin anzubieten.
So gelang es der amerikanischen Firma Myriad über eine Hand voll vom EPA erteilter Patente eine Reihe in Europa bereits allgemein angewendeter Brustkrebstests zu patentieren. Dadurch, dass Myriad in Folge die Durchführung dieser an sich günstigen und bereits erfolgreich klinisch angewendeten Tests in Europa dadurch verbieten lassen konnte und seither die Durchführung dieser Test nur in den firmeneigenen Labors in den USA geschieht, müssen die Blutproben in die Vereinigten Staaten geschickt werden. Myriad hat zudem einen sehr hohen Preis für diese Tests angesetzt, die zuvor bereits viele Labore preisgünstiger durchgeführt haben. Des Weiteren gelang es Myriad durch diese Patenterteilungen, dass alle zukünftigen Entdeckungen zum entsprechenden Gen auf 20 Jahre unter ihrem Monopol stehen. (Quelle: wikipedia)
Welches Unternehmen wird denn unter diesen Umständen noch weitere Forschungsmittel in die Forschung an diesen Genen investieren? In 20 Jahren geht es erst weiter damit.
Es ist also nicht eine Frage der Gerechtigkeit, sondern eine der finanziellen Möglichkeiten und des juristischen Geschicks, wer ein Patent für eine Erfindung erhält: Nicht darauf kommt es an, die Erfindung wirklich selbst gemacht zu haben, oder wirklich etwas nicht triviales oder bereits bekanntes hervorgebracht zu haben, sondern darauf, als schnellster mit den Unterlagen und mit einer guten Rechtsbteilung beim Patentamt gewesen zu sein. Ein kurioser Zustand. Denn der wirkliche Erfinder geht so u.U. leer aus, und die Allgemeinheit wird für Patente geschröpft, die es selbst nach geltendem Recht eigentlich nicht geben dürfte.
Die Menschheit hat es ganz ohne Patente auf einen beachtlichen Entwicklungsstand gebracht. Erst seit 1877 werden Patente im heutigen Sinne des Wortes erteilt. Soll der Fortschritt der Menschheit in Zukunft nicht vom Gutdünken einiger Patentinhaber oder -Aufkäufer abhängen, muß dieses unseelige Patentwesen schleunigst wieder abgeschafft werden, statt es weiter auszubauen.
Wie der Leiter der SAP-Patentabteilung, Günther Schmalz, auf der Tagung äußerte:
"Es geht wieder los".
Grüße
Funkenzupfer.